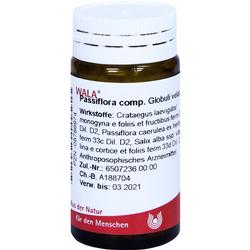Tipps für den Alltag
Schlafdefizit bei Kindern: Leider keine Seltenheit

© patat iStock Getty Images Plus
"Schlaf, Kindlein, schlaf …" das alte Wiegenlied erzählt von längst vergangenen Zeiten, da Väter noch Schafe hüteten und Mütter Träume von Bäumen schüttelten (also am Bett ein Gute-Nacht-Lied gesungen, eine Geschichte oder anderes erzählt haben) – in Ermangelung der Möglichkeit des spätabendlichen Konsums von Fernsehserien, Filmen, Musik, Spielen und Chat-Dialogen in den eigenen vier Kinderzimmer-Wänden. Dank des Fortschritts braucht heute kein schulpflichtiges Kind mehr nach dem Zubettgehen vor lauter Langeweile zügig einzuschlafen. Tatsächlich schätzen Schlafforscher, dass unter anderem aus diesem Grund bereits jedes dritte Kind, vom Baby bis zum Jugendlichen, Ein- und/oder Durchschlafschwierigkeiten hat – und dieses Schlafdefizit wirkt sich aus auf die körperliche und geistige Entwicklung, auf das Immunsystem, auf die Fähigkeit, sich beispielsweise Lerninhalte zu merken.
Säuglinge und Kleinkinder, die Schwierigkeiten haben, einen sinnvollen Tag-Nacht-Rhythmus zu finden oder (alleine) einzuschlafen, haben meist Gelegenheit, die mangelnde nächtliche Erholung tagsüber auszugleichen. Anders verhält sich das jedoch bei Schulkindern: Sie haben keine Möglichkeit, den versäumten Schlaf nachzuholen und sind tagsüber, insbesondere am Vormittag, müde und unkonzentriert, können sich häufig an das tags zuvor Gelernte kaum erinnern und fallen eher durch Infektanfälligkeit als durch gute schulische Leistungen auf. Während wir schlafen, werden die vielen Informationen und Reize, die unser Gehirn permanent verarbeitet, sortiert – Wichtiges und Nützliches wird im Langzeitgedächtnis gespeichert, denn während wir wach sind, ist dafür schlicht keine Zeit.
Aus Erhebungen der DAK (Präventionsradar 2018, über 9.000 Schüler der Klassen 5 bis 10 wurden befragt) geht hervor, dass ein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Zeit, die vor Bildschirmen jeglicher Art (Mobiltefone eingerechnet) verbracht wird, und der Schlafdauer: Jene, die derartige Geräte länger als vier Stunden täglich nutzen, gaben an, durchschnittlich 7,3 Stunden zu schlafen, jene, die weniger als eine Stunde auf Displays starren, brachten es dagegen auf 8,9 Stunden Schlaf.
Obwohl auch bei Kindern das Schlafbedürfnis individuell ist, zeichnet sich ab, dass Wenig-Schläfer mangels Konzentration nicht nur Unterrichtsinhalte verpassen und das dennoch Erfasste schlechter speichern können, sondern zudem das Risiko von (Schul-)Unfällen und Verletzungen vergleichsweise hoch ist.
Eltern sollten also die Anzeichen beachten, die auf ein Schlafdefizit beim Nachwuchs hindeuten; auch ein Gespräch mit den Erziehern/Pädagogen kann Aufschlüsse darüber geben, ob ein Kind genügend Schlaf abbekommt, um sich gut entwickeln zu können.